schon seit einigen Wochen hege ich den Wunsch einen Thread rund um das große Themenfeld Philosophie zu erstellen.
Ich werde mich hier fast auschließlich auf die europäische Philosophie beschränken, angefangen bei den Vorsokratikern der klassischen hellenistischen — bis hin zur modernen Philosophie. Damit will ich die Bedeutung orientaler —, indischer — und fernstost-asiatischer Philosophie keineswegs schmälern. Der Grund dafür, dass sie bei mir kaum bis gar nicht zur Sprache kommen, liegt einfach darin begründet, dass ich so gut wie nichst dazu weiß und daher darüber nicht sprechen kann.
Laut Prof. P. Hoyningen-Huene begann die hellenstische Philosophie vor 2700 bis 2500 Jahren, meines Wissens mit den miletischen Naturphilosophen, deren Werke uns vorwiegend in der Textgattung der Lehrgedichte überliefert wurden. Sie waren also Dichter und Philosophen, welche der in der Frühantike revolutionären Idee folgten, die Welt nicht mehr mythologisch, sondern mit Hilfe des Verstandes zu deuten.
Zitatquelle: Vorsokratik - Von Thales bis HeraklitDie milesische Naturphilosophie versucht sich an einem Verständnis der Welt abseits der bekannten religiös-mythologischen Traditionen. Bei allen Irrtümern, die den frühen ionischen Naturphilosophen unterlaufen, zeichnen sie sich durch ein sensationelles Merkmal aus: Sie wollen die Welt mit den Mitteln des Verstandes begreifen und verzichten zugunsten eines Mehr an Rationalität auf den Rückgriff auf religiös-mythologische Deutungsmuster.
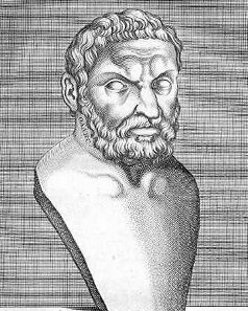
Dabei bedienten sie sich der Form der Lehrgedichte vermutlich deshalb, weil dies günstige für die Mnemotechnik war. Durch diese Erinnerungskunst war es möglich, Reime zu rekonstruieren, wenn Teile von ihnen vergessen wurden. Diese Textgattung entsprach noch nicht der sich entwickelnden klassisch-hellenistischen Schriftkultur und schöpfte wahrscheinlich aus der mündlichen Überlieferungskultur der Dichterbarden und Lieder. Ein Beispiel hierfür ist Homers Iliás.
Auch ganz ohne Philosophie nimmt der Mensch seine Lebewelt wahr. Er erkennt Dinge wie Bäume, Vögel, Steine und Wasser und kann ihnen Qualia wie nass, weich oder hart, warm oder kalt usw. zuschreiben. Doch nun hält er ein Ruder ins Wasser und beobachtet wie das Ruder abknickt. Wie sollte er sich dieses Phänomen erkären (was selbst rund zweitausend Jahre später Newton nicht erklären konnte)? Vier mögliche Reaktionen werde ich im Folgenden kurz ausreißen:
I. Ignoranz
Der Ruderer ignoriert das Phänomen und nimmt es einfach hin. Diese Geisteshaltung scheint mir alten Schöpfungsmythen zugrunde zu liegen, denn in diesen erschaffen die Götter die Welt aus formloser Materie, die schon immer da war und nicht creatio ex nihilo.
Anstelle eines theoretischen Nachgrübelns fokussiert diese Geisteshaltung das Denken auf praktische Probleme, welche der antike Mensch im täglichen Überlebenskampf meistern musste.
II. Aspekthypothesen
Man leitet aus dem Aspekt, dass das Ruder im Wasser abknickt, die Hypothese ab, dass es an Wasseroberfläche tatsächlich abknickt.
Ein anderer Aspekt des Phänomens wird wahrgenommen, wenn man das Ruder mit der Hand ertastet und fühlt, dass das Ruder NICHT abgeknickt ist. Diesen Widerspruch könnte damit erkärt werden, dass die Hand eine verzerrte Wahrnehmung ertastet, denn auch der Arm "knickt" im Wasser sichtbar ab.
Beobachtung und Ertastung vermitteln also zwei Aspekte des Phänomens.
III. Akzeptanz des Widerspruchs
Anstatt zu versuchen den Widerspruch aufzulösen, kann man ihn auch "akademisch" akzeptieren, indem man folgert, dass beide Aspekte wahr sind.
IV Illusion
Das Abknicken wird als Illusion gedeutet. Die Sinne können einen täuschen.
Dies scheint mir ein Vorläufer von Platons Höhlengleichnis und Descartes' erste Meditation zu sein. Die Sinne offenbaren uns nicht die Wirklichkeit der Dinge, sondern lassen uns nur Erscheinungen wahrnehmen. Daher postulieren die Mileter eine konstante Substanz, welche der Urgrund aller Erscheinungen ist, die durchlitten werden. War es bei Thales noch das Wasser, war es bei seinem Schüler Anaximander von Milet sowas wie die Urmaterie.
Wie Thales geht es auch Anaximander um den Urgrund aller Dinge. Aber für Anaximander ist dieser nicht das Wasser, sondern das Apeiron (das grenzenlos Unbestimmbare). Aus dieser Substanz, welche nicht genau bestimmbar ist, geht alles hervor. Sie steuere alles und sei unvergänglich.
Dies soll für den Eröffnungsbeitrag genügen. Später setzte ich meine Ausführungen mit den Pythagoreern und Xenophanes fort.
